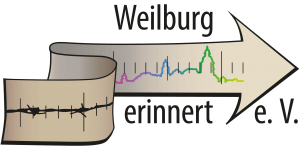„Ich bin erst 17 und möchte zu meiner Mutter“
Jürgen Weil
April 1945, kurz vor Kriegsende im Lager der Heinkel-Werke bei Oranienburg: Auf den Knien fleht der 17-jährige Fryderyk Jakimisyn in gebrochenem Deutsch um sein Leben, in Todesangst umfasst er die Beine des deutschen Soldaten. Das berührt diesen dann doch und er schießt nicht. Jakimisyn überlebt auch den anschließenden Todesmarsch tausender Lagerhäftlinge Richtung Berlin. Erst am 2. Mai ist das Grauen zu Ende.
Auf Einladung von Markus Huth, Vorsitzender des Vereins „Weilburg erinnert“, erzählen zwei der letzten Zeitzeugen der NS-Verbrechen im mit über 50 Zuhörern vollbesetzten „Kleinen Kabinett“ des Bergbau- und Stadtmuseums Weilburg ihre Leidensgeschichten. Die Polen Fryderyk Jakimisyn und Bogdan Chrześciański sind Teilnehmer des Zeitzeugenprojektes des Bistums Limburg, sie kommen aktuell mit täglich über 200 Schülerinnen und Schülern der Region im Priesterseminar ins Gespräch. Der verantwortliche Leiter, Marc Fachinger, hat Dolmetscherin Marianne Drechsel-Gillner mit nach Weilburg gebracht, die sich ehrenamtlich für das Maximilian-Kolbe-Werk engagiert. Die humanitäre Organisation mit Sitz in Freiburg leistet Hilfe für die Überlebenden der Konzentrationslager, steht für Verständigung und Versöhnung und vermittelt die letzten Zeitzeugen.
Bogdan Chrześciański wurde am 7. Januar 1945 unter entsetzlichen Bedingungen im Schmutz der Baracken des Frauenlagers des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau geboren. Er berichtet, was ihm später seine Mutter erzählt hat: Von Hunger und Angst, von den Misshandlungen auch der Schwangeren, ihren Schreien bei den Geburten, die wenige Hebammen begleiten, dem Sterben der Babys, deren Mütter anderen wie Bogdan dann aber zum Überleben verhelfen. Sein Vater, nach der Verhaftung während des Warschauer Aufstandes bei der Deportation von seiner Frau getrennt, ist da schon tot, wie er erst 1987 bei Recherchen im Archiv der internationalen Suchstelle von Bad Arolsen erfahren hat. Mit Glück überstehen Mutter und Kind und 34 andere die letzten drei Wochen bis zur Befreiung des Lagers Auschwitz am 27. Januar 1945. Sie werden von Helfern des polnischen und schwedischen Roten Kreuzes aufgepäppelt. Lange kränkelnd stirbt Bogdans Mutter 1960.
Fryderyk Jakimisyn, inzwischen 91 Jahre alt, „Bauingenieur in Rente“, wie er sagt, hat in seinem Lagerleben von Januar 1944 bis April 1945 „mehr Leichen als lebende Menschen gesehen“. Die Aussage schockt die Zuhörer, unter ihnen erfreulich viel junge Gesichter. Einer der Jüngsten, Tim (11), wie sein Bruder Dorian (14) und seine Schwester Janina (16) sehr geschichtsinteressiert, in Begleitung der Mutter Patricia Sartorius, sagt: „Die Gelegenheit der persönlichen Begegnung mit Zeitzeugen ist für mich wertvoller als jedes Nachlesen in Büchern.“ Und so hängt er aufmerksam an den Lippen zuerst des Erzählers, dann der Übersetzerin. Fryderyk Jakimisyn ist im KZ Groß-Rosen nur noch eine Nummer, Häftling 91937. Er wird Augenzeuge, wie hier täglich Hunderte sterben: Polen, Russen, Tschechen, Jugoslawen, Juden. Bei der schweren Arbeit im nahen Steinbruch, an Unterernährung, Erschöpfung, Erfrierungen, bei willkürlichen Erschießungen. Kleinste Vergehen, wie kurzes Ausruhen, beim Appell nicht rechtzeitig die Mütze abgenommen, werden mit dem Tode bestraft. Die Toten, manchmal auch Sterbende, im nahen Krematorium verbrannt. Es ist 24 Stunden in Betrieb, sein süßlicher Geruch hängt über dem Lager.
„Unter den ständigen Entwürdigungen, Schlägen, der Angst, den perfiden Methoden der Vernichtung“, sagte Jakimisyn, „schwindet der Lebenstrieb.“ Was ihm aber Kraft gab, weiß er nicht genau, „vielleicht, weil ich jung war, alle Scham und das Nachdenken ausschalten konnte. Tägliche Gebete halfen etwas, auch Freundschaften untereinander.“ Doch es wurde noch schlimmer. Deportation zu den Lagern Dora und Nordhausen, vier Tage eingepfercht in Viehwaggons, er muss mithelfen, die täglichen Toten in die beiden hinteren Waggons zu schleppen. In Dora Liquidierungen der Kranken und Schwachen, Bombadierung Nordhausens, aber auch des Lagers durch die Alliierten, Überleben in Erdlöchern bei weiteren Fliegerangriffen. Deportation in das zerstörte Lager der Heinkel-Werke, Verstecken bei der erneuten Evakuierung, von den deutschen Patrouillen wieder eingefangen, knapp der Erschießung entgangen, weiter gezwungen, auf Todesmärsche Richtung Berlin. Entkräftete bleiben am Wegesrand zurück, werden erschossen oder lassen sich freiwillig erschießen. In Nachtpausen verzweifelte Suche nach Essbarem, Regenwürmer, Schnecken. Nach der Befreiung durch russische Soldaten am 2. Mai ein erstes positives Erlebnis: Ein ähnlich junger Russe überlässt dem Halbverhungerten zwei Brötchen.
„Furchtbar!“, sagt Dorian, diese Erlebnisse haben den Vierzehnjährigen am stärksten beeindruckt. Seine Schwester Janina Sartorius vom Kinder- und Jugendparlament, „emotional tief berührt“, wie sie sagt, fragt nach, ob Fryderyk Jakimisyn den Deutschen etwas nachträgt. Tut er nicht, sagt er, weil er weiß, was Angst in der Hitlerzeit mit den Menschen gemacht hat und weil er bei seinen fünf Besuchen inzwischen ein völlig anderes Deutschland erlebt hat. Und als Heiko Wenzelmann sagt, „unser Außenminister Maas ist nach eigener Aussage wegen Auschwitz in die Politik gegangen, ich bin aus dem gleichen Grund Polizist geworden“, huscht bei der Übersetzung ein zufriedenes Lächeln über sein Gesicht und formt er die Hände zum stillen Beifall. Genau das sei Ziel des jungen Vereins „Weilburg erinnert“, sagt Markus Huth bei seinen Dankesworten, „rechtzeitig aufzustehen gegen erneuten Hass, gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus. Durch eine aktive Erinnerungs- und Gedenkkultur aus der Vergangenheit für eine friedliche Zukunft zu lernen, damit sich Auschwitz nie wiederholt.“